
Prozessmanagement mit der PICTURE-Prozessplattform
Prozessmanagement mit der PICTURE-Prozessplattform: Systematische Erhebung und Optimierung von Verwaltungsprozessen
Verwaltungsprozesse sind das Herzstück jeder öffentlichen Organisation – und gleichzeitig oft ihre größte Schwachstelle. Während die meisten Verwaltungen ihre Aufbauorganisation detailliert dokumentieren, bleiben die tatsächlichen Arbeitsabläufe häufig im Verborgenen. Diese Intransparenz führt zu Ineffizienzen, Qualitätsproblemen und erschwert jede Form der Optimierung oder Digitalisierung. Die Lösung liegt in systematischem Prozessmanagement – und hier hat sich die PICTURE-Prozessplattform als bewährtes Werkzeug etabliert.
Das Problem: Verwaltung im Blindflug
In den meisten Verwaltungen existiert ein paradoxer Zustand: Während Organigramme aktuell gehalten und Stellenbeschreibungen regelmäßig überarbeitet werden, bleiben die tatsächlichen Arbeitsprozesse weitgehend undokumentiert. Mitarbeitende wissen zwar, wie sie ihre Aufgaben erledigen, doch dieses Wissen ist oft implizit und an Personen gebunden.
Diese Situation führt zu messbaren Problemen: Neue Mitarbeitende benötigen unverhältnismäßig lange Einarbeitungszeiten, da es keine standardisierten Prozessbeschreibungen gibt. Unterschiedliche Bearbeitungsweisen für ähnliche Fälle entstehen, weil jeder Mitarbeitende seine eigene Variante des Prozesses entwickelt. Optimierungspotenziale bleiben unentdeckt, da niemand den Gesamtprozess überblickt. Digitalisierungsprojekte scheitern oder bleiben hinter den Erwartungen zurück, weil die zugrundeliegenden Prozesse nicht verstanden sind.
Die Ursache liegt in der traditionellen Organisationssicht, die primär auf Zuständigkeiten und Hierarchien fokussiert. Prozesse schneiden jedoch quer durch diese Strukturen und erfordern eine andere Betrachtungsweise. Was fehlt, ist eine systematische Methodik zur Prozesserhebung, -dokumentation und -optimierung.
Die Lösung: Systematisches Prozessmanagement mit bewährten Werkzeugen
Professionelles Prozessmanagement beginnt mit der Erkenntnis, dass Verwaltungsleistungen das Ergebnis von Prozessen sind, nicht von isolierten Einzelaktivitäten. Ein strukturiertes Vorgehen macht diese Prozesse sichtbar, verstehbar und gestaltbar. Die PICTURE-Prozessplattform bietet hierfür eine erprobte technologische Grundlage, die bereits in über 640 Kommunen erfolgreich eingesetzt wird.
Der Kern eines systematischen Prozessmanagements liegt in der strukturierten Herangehensweise: Zunächst werden die relevanten Verwaltungsprozesse identifiziert und priorisiert. Anschließend erfolgt die detaillierte Erhebung der Ist-Prozesse unter Einbeziehung aller Beteiligten. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in standardisierte Prozessmodelle überführt, die als Grundlage für Analyse und Optimierung dienen. Schließlich werden verbesserte Soll-Prozesse entwickelt und implementiert.
Diese Systematik unterscheidet professionelles Prozessmanagement von ad-hoc-Optimierungen oder isolierten Digitalisierungsprojekten. Statt Symptome zu behandeln, werden die zugrundeliegenden Strukturen analysiert und neu gestaltet.
Die PICTURE-Methodik: Von der Erhebung zur Optimierung
Die praktische Umsetzung folgt einem bewährten Dreischritt: Prozesserhebung, Modellierung und Optimierung. Jeder Schritt baut auf den vorherigen auf und wird durch die PICTURE-Plattform technisch unterstützt.
Schritt 1: Systematische Prozesserhebung
Die Prozesserhebung beginnt mit der Identifikation der erfolgskritischen Verwaltungsprozesse. Nicht alle Abläufe verdienen die gleiche Aufmerksamkeit – eine strategische Auswahl fokussiert auf jene Prozesse, die entweder besonders häufig durchlaufen werden, hohe Ressourcenbindung aufweisen oder kritische Bürgerkontakte umfassen.
Um die Zeit der Mitarbeitenden optimal zu nutzen und ihre Ressourcen zu schonen, schalten wir eine strukturierte Online-Befragung vor. Diese erfasst die Grundinformationen zum Prozess: wesentliche Prozessschritte, Auslöser und Ergebnis des Prozesses, relevante rechtliche Rahmenbedingungen und eingesetzte Fachverfahren. Auf Basis dieser Vorabinformationen können unsere Berater bereits erste Modellierungsentwürfe erstellen.
Diese Vormodellierung hat sich als entscheidender Erfolgsfaktor erwiesen: Fachexperten können sich Prozesse oft nicht abstrakt vorstellen. Erste konkrete Modellierungsentwürfe erleichtern die Zusammenarbeit erheblich und ermöglichen es, die wertvollen Ressourcen der Mitarbeitenden effizient zu nutzen.
Die eigentliche Erhebung erfolgt dann in moderierten Workshops mit den Prozessbeteiligten. Diese Workshops haben eine doppelte Funktion: Sie dienen der Informationsgewinnung und gleichzeitig der Bewusstseinsbildung für Prozessdenken. Durch gezielte Fragetechniken wird das implizite Prozesswissen der Mitarbeitenden explizit gemacht. Die Vormodellierung bietet dabei einen konkreten Gesprächsanker, an dem sich die Diskussion orientieren kann.
So entsteht ein vollständiges Bild des tatsächlichen Prozessablaufs – nicht wie er sein sollte, sondern wie er wirklich gelebt wird.
Schritt 2: Standardisierte Modellierung nach BPMN 2.0
Die erhobenen Prozessinformationen werden in den international anerkannten BPMN 2.0-Standard überführt. Diese Notation bietet eine einheitliche Sprache für Prozessbeschreibungen und gewährleistet, dass die Modelle auch außerhalb der ursprünglichen Projektgruppe verstanden werden können.
PICTURE unterstützt diese Modellierung durch intuitive grafische Werkzeuge und umfangreiche Vorlagenbibliotheken. Besonders wertvoll ist dabei der Zugriff auf eine umfangreiche Prozessdatenbank aus nahezu allen Aufgabenfeldern der öffentlichen Verwaltung. Diese ermöglicht es, bewährte Lösungsansätze und Best-Practice-Beispiele direkt in die Modellierung einzubeziehen.
Die Modellierung erfolgt nicht isoliert, sondern in enger Abstimmung mit den Fachexperten aus der Verwaltung. Durch die Cloud-basierte Architektur von PICTURE können alle Beteiligten in Echtzeit auf die Modelle zugreifen, Feedback geben und Änderungsvorschläge einbringen. So entsteht ein kollaborativer Entwicklungsprozess, der die Expertise aller Beteiligten einbezieht.
Schritt 3: Systematische Prozessoptimierung
Auf Basis der validierten Ist-Modelle werden Optimierungspotenziale systematisch identifiziert. Dabei kommen bewährte Analyse-Techniken zum Einsatz: Die Wertschöpfungsanalyse identifiziert Aktivitäten, die keinen direkten Beitrag zum Prozessergebnis leisten. Die Schnittstellenanalyse deckt Reibungsverluste bei Übergaben zwischen verschiedenen Organisationseinheiten auf. Die Medienbruchanalyse identifiziert Stellen, an denen Informationen zwischen verschiedenen Systemen oder Medien übertragen werden müssen.
Diese Analysen münden in konkrete Optimierungsvorschläge: Eliminierung überflüssiger Aktivitäten, Zusammenlegung ähnlicher Prozessschritte, Parallelisierung bisher sequenzieller Abläufe oder Automatisierung standardisierter Routinetätigkeiten. Besonders wertvoll ist die systematische Betrachtung von Genehmigungsschleifen und Kontrollinstanzen auf ihre tatsächliche Notwendigkeit.
Die optimierten Soll-Prozesse werden wieder in PICTURE modelliert und können so direkt mit den Ist-Prozessen verglichen werden. Diese Transparenz erleichtert die Kommunikation der Verbesserungsvorschläge und schafft Verständnis für die Notwendigkeit von Veränderungen.
Qualitätssicherung durch digitale Kollaboration
Ein entscheidender Erfolgsfaktor liegt in der systematischen Qualitätssicherung während des gesamten Prozesses. PICTURE ermöglicht hier einen innovativen Ansatz der digitalen Kollaboration zwischen Beratern und Verwaltungsexperten.
Statt der traditionellen Vorgehensweise – Berater erstellen Prozessmodelle und präsentieren sie der Verwaltung – etabliert die cloud-basierte Lösung einen kontinuierlichen Dialog. Fachexperten aus der Verwaltung können direkt in der PICTURE-Umgebung Feedback zu den entwickelten Prozessmodellen geben, Korrekturen vorschlagen und alternative Abläufe einbringen.
Dieser kollaborative Ansatz führt zu mehreren Review-Schleifen, in denen die Prozessmodelle schrittweise verfeinert werden. Jede Änderung ist für alle Beteiligten transparent nachvollziehbar, und verschiedene Versionen können systematisch verglichen werden. So entsteht am Ende ein Prozessmodell, das nicht nur analytisch korrekt ist, sondern auch die Praxiserfahrung aller Beteiligten widerspiegelt.
Die digitale Kollaboration hat einen weiteren wichtigen Nebeneffekt: Sie fördert den Wissenstransfer von den Beratern zu den Verwaltungsmitarbeitenden. Statt passiver Empfänger von Beratungsleistungen werden sie zu aktiven Mitgestaltern des Optimierungsprozesses. Dies stärkt die interne Prozesskompetenz und schafft die Grundlage für eine eigenständige Weiterentwicklung nach Projektabschluss.
Flexible Implementierung je nach Kundenanforderung
Das erste Ziel professionellen Prozessmanagements ist die Schaffung von Transparenz über die tatsächlichen Arbeitsabläufe. Viele Verwaltungen verfügen zwar über formale Prozessbeschreibungen, diese bilden jedoch nicht die gelebte Realität ab. Systematisches Prozessmanagement macht sichtbar, wie Arbeit wirklich verrichtet wird, wo Probleme entstehen und welche informellen Lösungen die Mitarbeitenden entwickelt haben.
Diese Transparenz ist die Grundlage für jede sinnvolle Digitalisierung. Nur wenn verstanden ist, wie Prozesse funktionieren, können digitale Lösungen entwickelt werden, die tatsächlich Verbesserungen bringen. Prozesstransparenz verhindert auch, dass wichtige Prozessschritte bei der Digitalisierung übersehen werden.
Entwicklung von Prozesskompetenz
Professionelles Prozessmanagement baut systematisch Prozesskompetenz in der Organisation auf. Mitarbeitende lernen, in Prozessen zu denken, Schnittstellen zu verstehen und Optimierungspotenziale zu erkennen. Diese Kompetenz ist entscheidend für erfolgreiche Digitalisierung, da sie die Grundlage für die konstruktive Mitgestaltung digitaler Lösungen bildet.
Prozesskompetenz ermöglicht es auch, digitale Systeme nach ihrer Implementierung kontinuierlich zu verbessern. Statt passive Anwender zu sein, werden die Mitarbeitenden zu aktiven Gestaltern ihrer digitalen Arbeitsumgebung. Sie können beurteilen, welche Funktionen hilfreich sind und welche die Arbeit erschweren.
Etablierung von Qualitätsstandards
Systematisches Prozessmanagement definiert klare Qualitätsstandards für Verwaltungsprozesse. Diese Standards umfassen nicht nur Durchlaufzeiten und Bearbeitungsqualität, sondern auch Aspekte wie Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Bürgerfreundlichkeit. Digitalisierung kann diese Standards dann konsequent umsetzen und überwachen.
Qualitätsstandards schaffen auch die Grundlage für die Messung von
Digitalisierungserfolgen. Ohne klare Prozessziele ist es unmöglich zu beurteilen, ob eine digitale Lösung tatsächlich Verbesserungen gebracht hat. Prozessmanagement etabliert die notwendigen Kennzahlen und Messverfahren für ein faktenbasiertes
Digitalisierungscontrolling.
Vorbereitung des Change-Managements
Digitalisierung bedeutet immer auch organisatorische Veränderung. Professionelles Prozessmanagement bereitet diese Veränderungen systematisch vor, indem es die Betroffenen frühzeitig einbezieht und die Auswirkungen der geplanten Änderungen transparent macht. Die partizipative Entwicklung optimierter Prozesse schafft Verständnis für die Notwendigkeit von Veränderungen und Akzeptanz für neue Arbeitsweisen.
Besonders wertvoll ist die Möglichkeit, neue Prozesse zunächst analog zu testen, bevor sie digitalisiert werden. Diese Erprobungsphase ermöglicht es, Probleme zu erkennen und zu lösen, bevor sie in teurer Software implementiert werden. Sie schafft auch Vertrauen in die geplanten Änderungen und reduziert Widerstände gegen die spätere Digitalisierung.
Erfolgspraxis: Systematische Transformation in der Bauantragsverwaltung
Die technische Umsetzung kann je nach den spezifischen Anforderungen und der bestehenden IT-Landschaft der Verwaltung flexibel gestaltet werden. PICTURE bietet hier zwei grundsätzliche Ansätze, die unterschiedliche Strategien der Prozess-Implementierung unterstützen.
Option 1: Direkte Modellierung in der bestehenden PICTURE-Umgebung Bei diesem Ansatz wird direkt in der bereits vorhandenen PICTURE-Umgebung der Verwaltung modelliert. Alle Prozessmodelle entstehen von Beginn an im System des Kunden und bleiben dort verfügbar. Dies ermöglicht eine nahtlose Weiternutzung nach Projektabschluss und fördert die eigenständige Pflege und Weiterentwicklung der Prozesslandschaft.
Option 2: BPMN 2.0-Export für bestehende Systeme Für Verwaltungen, die bereits andere Prozessmanagement-Tools nutzen oder die Modelle in ihre bestehende Dokumentationslandschaft integrieren möchten, werden alle erarbeiteten Prozesse im standardisierten BPMN 2.0-Format bereitgestellt. Diese können dann problemlos in andere Systeme importiert oder als eigenständige Dokumentation genutzt werden.
Diese Flexibilität gewährleistet, dass die Investition in Prozessmanagement unabhängig von technologischen Entscheidungen nachhaltig bleibt. Die erarbeiteten Prozessmodelle behalten ihren Wert, auch wenn sich die technologische Umgebung ändert.
Entscheidend für den langfristigen Erfolg ist jedoch die Möglichkeit zur eigenständigen Pflege der Prozesse durch die Verwaltung selbst. Prozesse sind lebendige Gebilde, die sich mit veränderten rechtlichen Anforderungen, neuen Fachverfahren oder organisatorischen Anpassungen weiterentwickeln. Ohne kontinuierliche Aktualisierung verlieren auch die besten Prozessmodelle nach kurzer Zeit ihren Nutzen und verkommen zu historischen Dokumenten ohne praktische Relevanz. Die gewählte technische Lösung muss daher eine einfache und intuitive Pflege durch die Fachbereiche ermöglichen.
Strategische Partnerschaft für nachhaltige Lösungen
Die langjährige Partnerschaft zwischen der GfV und PICTURE ermöglicht es, Kunden attraktive Konditionen und umfassende Unterstützung anzubieten. Diese strategische Zusammenarbeit geht weit über die reine Lizenzierung hinaus und umfasst die gesamte Implementierungskette.
Für Verwaltungen, die sich nach dem Beratungsprojekt für eine eigenständige Nutzung von PICTURE entscheiden, bietet die GfV eine strukturierte Implementierungsbegleitung. Diese reicht vom Aufbau eines organisationsinternen Prozessmanagement-Konzepts über die Definition notwendiger Standards auf der Plattform bis hin zu umfassenden Schulungsprogrammen.
Die Schulungsangebote sind differenziert auf verschiedene Rollen zugeschnitten: Prozessmodellierer erhalten technische Trainings für die PICTURE-Nutzung, Prozessverantwortliche lernen die methodischen Grundlagen des Prozessmanagements, und Prozesseigner werden in die strategische Steuerung der Prozesslandschaft eingeführt.
Dieser Full-Service-Ansatz – vom initialen Beratungsprojekt bis zur nachhaltigen internen Prozessmanagement-Kompetenz – unterscheidet die GfV von Anbietern, die nur punktuelle Beratungsleistungen erbringen. Das Ziel ist nicht die Abhängigkeit des Kunden, sondern seine Befähigung zu eigenständigem, professionellem Prozessmanagement.
Erfolgsfaktoren für nachhaltiges Prozessmanagement
Die Erfahrung aus über 18 Jahren Prozessberatung in der öffentlichen Verwaltung zeigt, dass bestimmte Faktoren über den nachhaltigen Erfolg von Prozessmanagement-Initiativen entscheiden. Diese gehen weit über die reine Methodik hinaus und betreffen organisatorische und kulturelle Aspekte.
Führungsunterstützung ist fundamental: Prozessmanagement verändert etablierte Arbeitsweisen und erfordert anfänglich zusätzlichen Aufwand. Ohne klares Commitment der Verwaltungsleitung verlaufen Initiativen im Sand. Entscheidend ist dabei nicht nur die formale Unterstützung, sondern die aktive Förderung von prozessorientiertem Denken.
Partizipation schafft Akzeptanz: Die besten Prozessmodelle bleiben wirkungslos, wenn sie nicht von den Mitarbeitenden gelebt werden. Die systematische Einbeziehung aller Prozessbeteiligten in die Entwicklung und Optimierung ist daher kein methodisches Nice-to-have, sondern ein kritischer Erfolgsfaktor.
Realistische Erwartungen vermeiden Enttäuschungen: Prozessmanagement ist ein mittelfristiger Entwicklungsprozess, kein Quick-Fix für alle organisatorischen Probleme. Realistische Ziele und ein strukturierter Implementierungsplan helfen dabei, die anfängliche Motivation über die Zeit zu erhalten.
Kontinuierliche Weiterentwicklung sichert Relevanz: Verwaltungsprozesse sind keine statischen Gebilde, sondern entwickeln sich mit veränderten Anforderungen weiter. Ein lebendiges Prozessmanagement etabliert Routinen für die regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Prozesslandschaft.
Ausblick: Von der Prozessoptimierung zur digitalen Transformation
Systematisches Prozessmanagement ist mehr als eine Methode zur Effizienzsteigerung – es ist die Grundlage für eine umfassende digitale Transformation der Verwaltung. Die in der Prozessanalyse gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen fundierte Entscheidungen über Digitalisierungsinvestitionen und schaffen die organisatorischen Voraussetzungen für deren erfolgreiche Umsetzung.
Verwaltungen, die ihre Prozesse systematisch verstehen und optimiert haben, sind besser positioniert für die Herausforderungen der kommenden Jahre: Sie können Digitalisierungspotenziale gezielter identifizieren, Automatisierungslösungen sinnvoller einsetzen und organisatorische Veränderungen strukturierter umsetzen.
Die PICTURE-Plattform bietet dabei nicht nur ein Werkzeug für die Prozessmodellierung, sondern eine Grundlage für das strategische Prozessmanagement der Zukunft. In Kombination mit der methodischen Expertise der GfV entsteht eine Lösung, die Verwaltungen nicht nur bei der aktuellen Optimierung unterstützt, sondern auch für zukünftige Herausforderungen rüstet.
Warum Prozessmanagement mit der GfV und PICTURE nachhaltige Verbesserungen schafft
Die GfV verbindet in über 140 Beratungsprojekten erprobte Methodik mit modernster Technologie zu einem umfassenden Prozessmanagement-Ansatz. Unsere langjährige Partnerschaft mit PICTURE ermöglicht nicht nur attraktive Konditionen, sondern auch eine nahtlose Integration von Beratung und Technologie.
Was unseren Ansatz auszeichnet:
- Umfangreiche Prozess-Expertise: 18+ Jahre Erfahrung in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung
- Bewährte Technologie: PICTURE als etablierte Plattform in über 640 Kommunen
- Kollaborative Methodik: Digitale Zusammenarbeit statt klassischer Berater-Kunden-Trennung
- Flexible Implementierung: Anpassung an bestehende IT-Landschaften und organisatorische Anforderungen
- Nachhaltige Befähigung: Vom Beratungsprojekt zur eigenständigen Prozessmanagement-Kompetenz
Wir verstehen Prozessmanagement nicht als technisches Projekt, sondern als Organisationsentwicklung, die Menschen und Technik gleichermaßen berücksichtigt. Das Ergebnis sind nicht nur optimierte Prozesse, sondern eine gesteigerte Problemlösungs- und Veränderungskompetenz der gesamten Verwaltung.
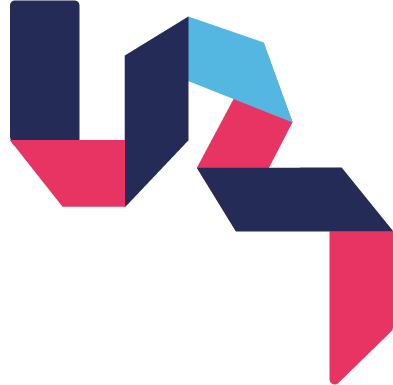
Kontaktieren Sie Uns
Wenn auch Sie Beratung auf Augenhöhe wünschen,
rufen Sie uns an und wir vereinbaren ein unverbindliches Erstgespräch.
0221-630 60 49 1
Oder hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten im folgenden Formular und wir werden auf Sie zurückkommen.





Neueste Kommentare