Prozessmanagement als Grundlage für Verwaltungsdigitalisierung: Warum schlechte analoge Prozesse zu schlechten digitalen Prozessen werden
Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist in vollem Gange. Milliarden werden investiert, neue Software implementiert und digitale Workflows eingeführt. Doch viele dieser Projekte bleiben hinter den Erwartungen zurück oder scheitern sogar vollständig. Der Grund liegt selten in der Technologie selbst, sondern in einem fundamentalen Denkfehler: der Annahme, dass Digitalisierung automatisch zu besseren Prozessen führt. Die Realität ist ernüchternd – ein schlechter analoger Prozess wird durch Digitalisierung zu einem schlechten digitalen Prozess, nur schneller.
Das Dilemma gescheiterter Digitalisierungsprojekte
In den meisten Verwaltungen folgt Digitalisierung einem vertrauten Muster: Ein analoger Prozess wird identifiziert, eine passende Software beschafft und der bestehende Ablauf digitalisiert. Was dabei übersehen wird, ist die kritische Frage nach der Qualität des zugrundeliegenden Prozesses. Ineffizienzen, Redundanzen und strukturelle Probleme werden nicht beseitigt, sondern in die digitale Welt fortgeschrieben.
Die Folgen sind messbar: Digitalisierungsprojekte, die ihre Effizienzziele verfehlen, weil die digitalisierten Prozesse genauso umständlich sind wie ihre analogen Vorgänger. IT-Systeme, die von den Mitarbeitenden umgangen werden, weil sie deren Arbeitsrealität nicht abbilden.
Hohe Folgekosten durch nachträgliche Anpassungen und Workarounds, die ursprünglich nicht geplant waren.
Ein typisches Beispiel: Eine Verwaltung digitalisiert ihr Antragsverfahren, ohne die zugrundeliegenden Genehmigungsschleifen zu hinterfragen. Das Ergebnis ist ein digitaler Prozess mit ebenso vielen Medienbrüchen und Verzögerungen wie zuvor – nur dass diese nun in einem teuren IT-System abgebildet sind. Die Bürger erleben keine spürbare Verbesserung, und die Mitarbeitenden müssen zusätzlich mit einer neuen Software kämpfen.
Das Problem liegt in der verbreiteten Annahme, dass Technologie per se Verbesserung bedeutet. Diese technikzentrierte Sichtweise übersieht, dass Digitalisierung nur so gut sein kann wie die Prozesse, die sie abbildet. Ohne fundiertes Prozessverständnis führt Digitalisierung zur kostspieligen Automatisierung bestehender Defizite in den Arbeitsabläufen.
Warum Technologie allein nicht reicht: Die Grenzen des technikzentrierten Ansatzes
Viele Digitalisierungsinitiativen folgen einem technikzentrierten Ansatz: Eine neue Software wird ausgewählt und implementiert, in der Hoffnung, dass sie bestehende Probleme löst. Diese Herangehensweise ignoriert jedoch die organisatorischen und prozessualen Realitäten der Verwaltung und führt zu vorhersagbaren Problemen.
Software diktiert Prozesse statt sie zu unterstützen: Wenn Prozesse nicht vorab durchdacht sind, bestimmt die Software, wie gearbeitet wird. Die Verwaltung passt sich dem System an, nicht umgekehrt. Dies führt zu umständlichen Workarounds und Frustration bei den Anwendern.
Schnittstellen werden übersehen: Verwaltungsprozesse erstrecken sich meist über mehrere Organisationseinheiten und IT-Systeme. Ohne systematische Prozessbetrachtung entstehen neue Medienbrüche zwischen digitalen und analogen Teilprozessen oder zwischen verschiedenen IT-Systemen.
Change-Management wird vernachlässigt: Neue Software zu implementieren ist eine technische Aufgabe. Neue Arbeitsweisen zu etablieren ist eine organisatorische Herausforderung, die systematisches Change-Management erfordert. Ohne Prozessverständnis fehlt die Grundlage für wirksame Veränderungsbegleitung.
Qualitätsprobleme bleiben unentdeckt: Digitalisierung macht Prozesse schneller, aber nicht automatisch besser. Qualitätsprobleme in analogen Prozessen – wie unklare Verantwortlichkeiten, fehlende Kontrollmechanismen oder uneinheitliche Standards – werden digitalisiert und sind dann schwerer zu erkennen und zu korrigieren.
Skalierungseffekte verstärken Probleme: Digitale Systeme ermöglichen die schnelle Bearbeitung großer Mengen. Wenn der zugrundeliegende Prozess fehlerhaft ist, potenzieren sich diese Fehler. Ein analoger Prozess mit 10% Fehlern wird zu einem digitalen Prozess mit 10% Fehlern – aber bei zehnfach höherem Durchsatz.
Erfolgreiche Digitalisierung erfordert daher einen systematischen Ansatz, der Prozessoptimierung und Technologieeinsatz intelligent verknüpft.
Der systematische Ansatz: Erst optimieren, dann digitalisieren
Erfolgreiche Verwaltungsdigitalisierung folgt einer klaren Systematik, die Prozessoptimierung und Technologieeinsatz intelligent verknüpft. Diese Systematik vermeidet die typischen Fallstricke technikzentrierter Ansätze und schafft die Grundlage für nachhaltige Verbesserungen.
Phase 1: Prozessverständnis entwickeln
Nicht alle Verwaltungsprozesse verdienen die gleiche Aufmerksamkeit bei der Digitalisierung. Eine strategische Auswahl fokussiert auf jene Prozesse, die entweder besonders häufig durchlaufen werden, hohe Ressourcenbindung aufweisen, kritische Bürgerkontakte umfassen oder erhebliche Optimierungspotenziale versprechen. Diese Priorisierung verhindert, dass Digitalisierungsressourcen in nebensächlichen Bereichen verschwendet werden.
Der erste Schritt ist dann die systematische Analyse der ausgewählten Prozesse. Dies geht weit über die bloße Dokumentation hinaus und umfasst das Verständnis der zugrundeliegenden Logik, der Schnittstellen und der tatsächlich gelebten Arbeitsweisen. Ohne dieses Fundament bleibt jede Digitalisierung oberflächlich.
Die Prozessanalyse erfasst nicht nur die formalen Abläufe, sondern auch die informellen Praktiken, die oft entscheidend für das Funktionieren der Verwaltung sind. Welche ungeschriebenen Regeln gibt es? Wo entstehen Reibungen zwischen verschiedenen Bereichen? Welche Workarounds haben die Mitarbeitenden entwickelt, um mit Defiziten des aktuellen Systems umzugehen?
Besonders wichtig ist die Betrachtung der End-to-End-Prozesse aus Bürgersicht. Viele Verwaltungsleistungen erscheinen aus interner Sicht effizient organisiert, erweisen sich aber aus Bürgerperspektive als fragmentiert und schwer nachvollziehbar. Eine ganzheitliche Prozessbetrachtung deckt diese Diskrepanzen auf und schafft die Basis für bürgerorientierte Digitalisierung.
Phase 2: Systematische Prozessoptimierung
Auf Basis des Prozessverständnisses erfolgt die systematische Optimierung der Abläufe. Die Optimierung orientiert sich an klaren Prinzipien: Reduzierung von Schnittstellen und Medienbrüchen, Parallelisierung bisher sequenzieller Abläufe, Eliminierung redundanter Aktivitäten und Standardisierung wiederkehrender Prozessschritte. Besondere Aufmerksamkeit gilt der kritischen Prüfung von Genehmigungsebenen und Kontrollschleifen auf ihre tatsächliche Notwendigkeit.
Ein zentrales Element ist die Simulation optimierter Prozesse, bevor sie digitalisiert werden. Pilotprojekte mit den neuen Abläufen zeigen, ob die theoretischen Verbesserungen auch praktisch funktionieren. Diese Erprobungsphase verhindert, dass strukturelle Probleme in die digitale Lösung übernommen werden.
Phase 3: Technologieauswahl und -implementierung
Erst nach der Prozessoptimierung erfolgt die Auswahl der geeigneten Technologie. Da die Anforderungen an das IT-System nun präzise definiert sind, kann eine fundierte Entscheidung getroffen werden. Die Software wird nicht nach verfügbaren Features ausgewählt, sondern nach ihrer Fähigkeit, die optimierten Prozesse bestmöglich zu unterstützen.
Die Implementierung erfolgt schrittweise und wird kontinuierlich mit den Prozesszielen abgeglichen. Anpassungen der Software werden nur vorgenommen, wenn sie die Prozessqualität verbessern, nicht um technische Möglichkeiten auszureizen. Diese Fokussierung verhindert die schleichende Überfrachtung mit Funktionen und hält die Lösung überschaubar.
Phase 4: Kontinuierliche Verbesserung etablieren
Digitalisierung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Die implementierten Systeme werden regelmäßig auf ihre Prozessunterstützung überprüft und bei Bedarf angepasst. Neue Anforderungen werden zunächst auf Prozessebene durchdacht, bevor technische Lösungen entwickelt werden.
Entscheidend ist die Etablierung einer Feedback-Kultur, in der sowohl Mitarbeitende als auch Bürger kontinuierlich Rückmeldungen zur Prozessqualität geben können. Diese Rückmeldungen fließen systematisch in die Weiterentwicklung ein und verhindern, dass sich die digitalen Prozesse von der Nutzerealität entfernen.
Wie professionelles Prozessmanagement Digitalisierung ermöglicht
Professionelles Prozessmanagement schafft die notwendigen Voraussetzungen für erfolgreiche Digitalisierung. Es geht dabei nicht nur um die einmalige Optimierung von Abläufen, sondern um die Etablierung einer prozessorientierten Organisationskultur, die kontinuierliche Verbesserung und systematische Digitalisierung ermöglicht.
Schaffung von Prozesstransparenz
Das erste Ziel professionellen Prozessmanagements ist die Schaffung von Transparenz über die tatsächlichen Arbeitsabläufe. Viele Verwaltungen verfügen zwar über formale Prozessbeschreibungen, diese bilden jedoch nicht die gelebte Realität ab. Systematisches Prozessmanagement macht sichtbar, wie Arbeit wirklich verrichtet wird, wo Probleme entstehen und welche informellen Lösungen die Mitarbeitenden entwickelt haben.
Diese Transparenz ist die Grundlage für jede sinnvolle Digitalisierung. Nur wenn verstanden ist, wie Prozesse funktionieren, können digitale Lösungen entwickelt werden, die tatsächlich Verbesserungen bringen. Prozesstransparenz verhindert auch, dass wichtige Prozessschritte bei der Digitalisierung übersehen werden.
Entwicklung von Prozesskompetenz
Professionelles Prozessmanagement baut systematisch Prozesskompetenz in der Organisation auf. Mitarbeitende lernen, in Prozessen zu denken, Schnittstellen zu verstehen und Optimierungspotenziale zu erkennen. Diese Kompetenz ist entscheidend für erfolgreiche Digitalisierung, da sie die Grundlage für die konstruktive Mitgestaltung digitaler Lösungen bildet.
Prozesskompetenz ermöglicht es auch, digitale Systeme nach ihrer Implementierung kontinuierlich zu verbessern. Statt passive Anwender zu sein, werden die Mitarbeitenden zu aktiven Gestaltern ihrer digitalen Arbeitsumgebung. Sie können beurteilen, welche Funktionen hilfreich sind und welche die Arbeit erschweren.
Etablierung von Qualitätsstandards
Systematisches Prozessmanagement definiert klare Qualitätsstandards für Verwaltungsprozesse. Diese Standards umfassen nicht nur Durchlaufzeiten und Bearbeitungsqualität, sondern auch Aspekte wie Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Bürgerfreundlichkeit. Digitalisierung kann diese Standards dann konsequent umsetzen und überwachen.
Qualitätsstandards schaffen auch die Grundlage für die Messung von
Digitalisierungserfolgen. Ohne klare Prozessziele ist es unmöglich zu beurteilen, ob eine digitale Lösung tatsächlich Verbesserungen gebracht hat. Prozessmanagement etabliert die notwendigen Kennzahlen und Messverfahren für ein faktenbasiertes
Digitalisierungscontrolling.
Vorbereitung des Change-Managements
Digitalisierung bedeutet immer auch organisatorische Veränderung. Professionelles Prozessmanagement bereitet diese Veränderungen systematisch vor, indem es die Betroffenen frühzeitig einbezieht und die Auswirkungen der geplanten Änderungen transparent macht. Die partizipative Entwicklung optimierter Prozesse schafft Verständnis für die Notwendigkeit von Veränderungen und Akzeptanz für neue Arbeitsweisen.
Besonders wertvoll ist die Möglichkeit, neue Prozesse zunächst analog zu testen, bevor sie digitalisiert werden. Diese Erprobungsphase ermöglicht es, Probleme zu erkennen und zu lösen, bevor sie in teurer Software implementiert werden. Sie schafft auch Vertrauen in die geplanten Änderungen und reduziert Widerstände gegen die spätere Digitalisierung.
Erfolgspraxis: Systematische Transformation in der Bauantragsverwaltung
Ein anschauliches Beispiel für den systematischen Ansatz bietet die Transformation der Bauantragsverwaltung einer mittelgroßen Stadt. Statt sofort eine neue Software zu implementieren, begann das Projekt mit einer umfassenden Prozessanalyse, die überraschende Erkenntnisse lieferte.
Die Ausgangslage: Komplexe analoge Abläufe
Der bestehende Bauantragsporozess erstreckte sich über fünf verschiedene Organisationseinheiten und umfasste 23 einzelne Prozessschritte. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit betrug 14 Wochen, wobei nur 20% der Zeit tatsächlich für die inhaltliche Bearbeitung verwendet wurden. 80% entfielen auf Wartezeiten, Weiterleitung und Abstimmungsprozesse.
Die Prozessanalyse deckte systematische Probleme auf: Unklare Zuständigkeiten führten zu Rückfragen und Verzögerungen. Parallele Prüfungen verschiedener Fachbereiche blockierten sich gegenseitig. Medienbrüche zwischen digitalen Fachverfahren und analogen Abstimmungsprozessen verursachten Informationsverluste und Doppelarbeiten.
Die Prozessoptimierung: Systematische Neugestaltung
Basierend auf den Analyseergebnissen wurde der Prozess grundlegend neu gestaltet. Kernelemente der Optimierung waren die Zusammenführung verwandter Prüfschritte, die Parallelisierung bisher sequenzieller Abläufe und die Definition klarer Eskalationswege für Problemfälle.
Besonders wirksam war die Einführung eines Case-Management-Ansatzes: Jeder Bauantrag erhielt einen festen Ansprechpartner, der für den gesamten Prozess verantwortlich war. Dieser koordinierte alle beteiligten Fachbereiche und sorgte für reibungslose Abläufe. Standardfälle konnten durch vordefinierte Workflows beschleunigt bearbeitet werden, während komplexe Fälle individuelle Betreuung erhielten.
Die optimierten Prozesse wurden zunächst in einem Pilotbereich getestet und schrittweise verfeinert. Erst nach der erfolgreichen Erprobung wurde mit der Digitalisierung begonnen.
Die Digitalisierung: Technologie folgt Prozess
Die Auswahl der IT-Lösung erfolgte auf Basis der optimierten Prozesse. Da die Anforderungen präzise definiert waren, konnte eine passende Software identifiziert werden, die den neuen Ablauf optimal unterstützte. Die Implementierung verlief ohne größere Probleme, da die Nutzer bereits mit den neuen Prozessen vertraut waren.
Das digitale System bildete die optimierten Abläufe exakt ab und automatisierte Routinetätigkeiten wie Fristenüberwachung, Statusupdates und standardisierte Kommunikation. Schnittstellen zu anderen Fachverfahren wurden systematisch integriert, um Medienbrüche zu vermeiden.
Die Ergebnisse: Messbare Verbesserungen
Die systematische Herangehensweise führte zu beeindruckenden Ergebnissen: Die durchschnittliche Bearbeitungszeit reduzierte sich von 14 auf 6 Wochen. Die Kundenzufriedenheit stieg deutlich, da die Antragsteller jederzeit den aktuellen Status verfolgen konnten. Die Mitarbeitenden berichteten von weniger Stress und mehr Zeit für die inhaltliche Bearbeitung.
Entscheidend war jedoch nicht nur die Effizienzsteigerung, sondern auch die nachhaltige Verbesserung der Prozessqualität. Das neue System bot umfassende Transparenz über alle Bearbeitungsschritte und ermöglichte kontinuierliche Optimierungen basierend auf konkreten Daten.
Integration in die digitale Verwaltungsstrategie
Prozessbasierte Digitalisierung darf nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss in eine übergreifende digitale Verwaltungsstrategie eingebettet sein. Diese Integration berücksichtigt verschiedene Dimensionen und schafft Synergien zwischen einzelnen
Digitalisierungsprojekten.
Strategische Ebene: Vision für die Digitalisierung entwickeln
Auf strategischer Ebene geht es um die Entwicklung einer Vision für die Digitalisierung der gesamten Verwaltung. Diese Vision definiert, welche Art von Verwaltung angestrebt wird: bürgerzentriert, effizient, transparent und proaktiv. Prozessmanagement trägt zur Operationalisierung dieser Vision bei, indem es konkrete Prozessziele ableitet und messbar macht.
Die Vision für die Digitalisierung schafft auch den Rahmen für Priorisierungsentscheidungen: Welche Prozesse sollen zuerst digitalisiert werden? Welche Qualitätsstandards gelten einheitlich? Wie sollen verschiedene IT-Systeme integriert werden? Ohne strategischen Rahmen führt Digitalisierung zu einem Flickenteppich isolierter Insellösungen.
Operative Ebene: Digitalisierungsroadmap erstellen
Auf operativer Ebene wird die Vision für die Digitalisierung in eine konkrete Roadmap übersetzt. Diese definiert die Reihenfolge von Digitalisierungsprojekten, berücksichtigt Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Prozessen und plant die erforderlichen Ressourcen. Prozessmanagement liefert die notwendigen Informationen für diese Planung.
Besonders wichtig ist die Berücksichtigung von Schnittstellen zwischen verschiedenen Prozessen. Die Digitalisierung eines Prozesses kann Auswirkungen auf vor- und nachgelagerte Abläufe haben. Eine systematische Roadmap plant diese Auswirkungen mit und vermeidet unbeabsichtigte Störungen.
Umsetzungsebene: Projekte professionell realisieren
Auf der Umsetzungsebene geht es um die professionelle Durchführung einzelner Digitalisierungsprojekte. Hier zeigt sich der Wert systematischen Prozessmanagements: Projekte mit solider Prozessgrundlage verlaufen effizienter, produzieren bessere Ergebnisse und werden von den Nutzern eher akzeptiert.
Die Umsetzungsebene umfasst auch die systematische Dokumentation von Erfahrungen und die Weiterentwicklung der Digitalisierungsmethodik. Jedes Projekt trägt zum organisationalen Lernen bei und verbessert die Fähigkeit für zukünftige Digitalisierungsvorhaben.
Nachhaltigkeit durch prozessbasierte Digitalisierung
Ein entscheidender Vorteil prozessbasierter Digitalisierung liegt in ihrer Nachhaltigkeit. Während technologiezentrierte Ansätze oft zu kurzlebigen Lösungen führen, schaffen prozessbasierte Ansätze die Grundlage für kontinuierliche Verbesserung und Anpassungsfähigkeit.
Adaptierbarkeit an veränderte Anforderungen
Verwaltungsanforderungen ändern sich kontinuierlich durch neue Gesetze, veränderte Bürgerbedürfnisse oder organisatorische Entwicklungen. Digitale Lösungen, die auf optimierten Prozessen basieren, können diese Änderungen besser bewältigen, weil die zugrundeliegende Prozesslogik klar definiert ist und flexibel angepasst werden kann.
Prozessbasierte Digitalisierung schafft auch die organisatorischen Voraussetzungen für kontinuierliche Anpassung. Mitarbeitende mit Prozesskompetenz können Veränderungsbedarfe früher erkennen und konstruktive Verbesserungsvorschläge entwickeln. Die Verwaltung wird zu einer lernenden Organisation, die ihre digitalen Arbeitsweisen kontinuierlich weiterentwickelt.
Technologieunabhängigkeit
Ein weiterer Nachhaltigkeitsvorteil liegt in der relativen Technologieunabhängigkeit prozessbasierter Ansätze. Da der Fokus auf den Prozessen liegt, nicht auf spezifischen Technologien, bleiben die Optimierungsergebnisse auch bei Technologiewechseln erhalten. Neue Software kann die bewährten Prozesse übernehmen und weiterentwickeln.
Diese Technologieunabhängigkeit reduziert auch das Risiko der Abhängigkeit von einzelnen Anbietern und ermöglicht strategischere Entscheidungen bei der Softwareauswahl. Die Verwaltung behält die Kontrolle über ihre Prozesse und kann Technologien nach ihrem Nutzen für die Prozessunterstützung bewerten.
Übertragbarkeit auf andere Bereiche
Erfolgreich digitalisierte Prozesse schaffen Vorbilder für andere Verwaltungsbereiche. Die entwickelte Methodik, die erprobten Qualitätsstandards und die gewonnenen Erfahrungen können systematisch auf weitere Prozesse übertragen werden. So entsteht ein Multiplikatoreffekt, der die Digitalisierung der gesamten Verwaltung beschleunigt.
Besonders wertvoll ist die Übertragbarkeit von Change-Management-Erfahrungen. Teams, die bereits erfolgreich Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben, können andere Bereiche bei deren Digitalisierungsvorhaben unterstützen und als interne Multiplikatoren wirken.
Ausblick: Die prozessgetriebene digitale Verwaltung der Zukunft
Verwaltungen, die Digitalisierung konsequent prozessbasiert angehen, entwickeln sich zu adaptiven, lernenden Organisationen. Sie verstehen Digitalisierung nicht als technisches Projekt, sondern als kontinuierlichen Organisationsentwicklungsprozess. Diese Haltung wird in einer zunehmend digitalen Welt zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Die digitale Verwaltung der Zukunft zeichnet sich durch nahtlose, bürgerorientierte Prozesse aus, die Technologie intelligent nutzen, um Verwaltungsleistungen zu verbessern. Dabei steht nicht die Technologie im Mittelpunkt, sondern der Nutzen für Bürger und Mitarbeitende. Prozessmanagement bildet das Fundament dieser zukunftsfähigen Verwaltung – es schafft die organisatorischen Voraussetzungen für erfolgreiche Digitalisierung und kontinuierliche Innovation.
Warum prozessbasierte Digitalisierung mit der GfV nachhaltige Transformation schafft
Die GfV verbindet über 18 Jahre Prozessmanagement-Erfahrung mit fundiertem Digitalisierungs-Know-how zu einem ganzheitlichen Transformationsansatz. Wir verstehen Digitalisierung nicht als IT-Projekt, sondern als Organisationsentwicklung, die Menschen, Prozesse und Technologie gleichermaßen berücksichtigt.
Was unseren Ansatz auszeichnet:
- Process-First-Philosophie: Systematische Prozessoptimierung vor Technologieauswahl
- Umfassende Verwaltungsexpertise: Erfahrung aus allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung
- Bewährte Transformationsmethodik: Erprobtes Vorgehen von der Analyse bis zur nachhaltigen Implementierung
- Technologiepartnerschaften: Zugang zu führenden Plattformen wie PICTURE für integrierte Lösungen
- Change-Management-Kompetenz: Systematische Begleitung organisatorischer Veränderungen
Wir entwickeln keine IT-Lösungen, sondern schaffen die prozessualen Grundlagen für erfolgreiche Digitalisierung. Das Ergebnis sind digitale Verwaltungsprozesse, die tatsächlich funktionieren, von den Nutzern akzeptiert werden und kontinuierlich weiterentwickelt werden können. Digitalisierung, die nachhaltig wirkt, weil sie auf optimierten Prozessen aufbaut.

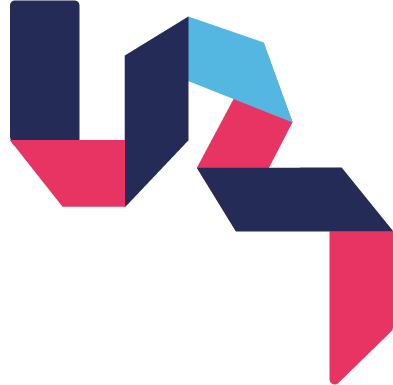





Neueste Kommentare